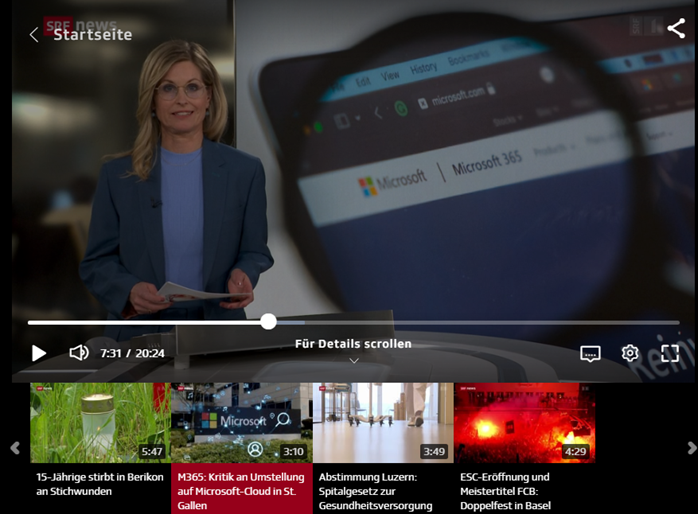Benedikt van Spyk, Staatssekretär und Leiter der St. Galler Staatskanzlei, nahm gegenüber SRF Stellung und verteidigte die Datenspeicherung in der Microsoft-Cloud. «Wir haben probiert, sowohl vertragliche (…) als auch organisatorische Massnahmen mit Microsoft zu machen.» Der Kanton mache klare Vorgaben wie: wo liegen die Schlüssel und wer darf darauf zugreifen. «Für uns der wichtigste Punkt: Diese Daten bleiben in der Schweiz», sagt van Spyk in der SRF-Sendung «Schweiz Aktuell».
Das Problem sei auch, dass es eigentlich keine Alternative zu Microsoft 365 gebe, so der Staatssekretär weiter.
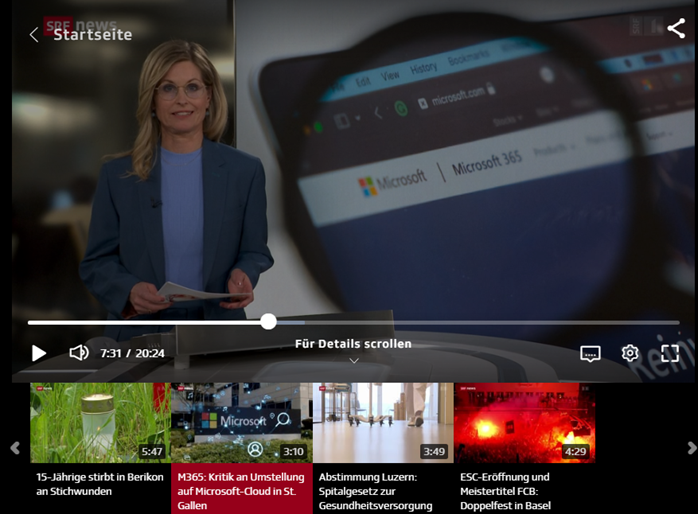
Wenn Schweizer Städte und Gemeinden – die sensible Informationen und personenbezogene Daten verarbeiten – ihre Daten auf Cloud-Servern von amerikanischen Unternehmen speichern, ist dies im Hinblick auf den Datenschutz und die Datensouveränität sehr heikel – egal, ob der Daten-Standort in den USA oder in der Schweiz liegt.
Im erwähnten Tätigkeitsbericht der kantonalen Fachstelle Datenschutz heisst es weiter: «Mit der Einführung von M365 sind die Mitarbeitenden verpflichtet, die Dokumente je nach Sensibilität selbst zu klassifizieren (Labeling). Dabei besteht das Risiko, dass Dokumente falsch klassifiziert werden.» Die FDS empfiehlt deshalb, zu prüfen, standardmässig sämtliche kritischen Dokumente mit «geheim» zu klassifizieren.
Die FDS veröffentlichte unter anderem mehrere Empfehlungen, beispielsweise, dass eine Exit-Strategie vorhanden sein muss und «wenn Daten von Bürgerinnen und Bürgern in der Cloud von Microsoft bearbeitet werden, muss dies transparent ausgewiesen werden». Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sei eine wichtige Voraussetzung für das Vertrauen der Bevölkerung in die Digitalisierung durch öffentliche Organe.